Von Rittern und Rüpeln – Das vergessene Kunst des Rückgrads
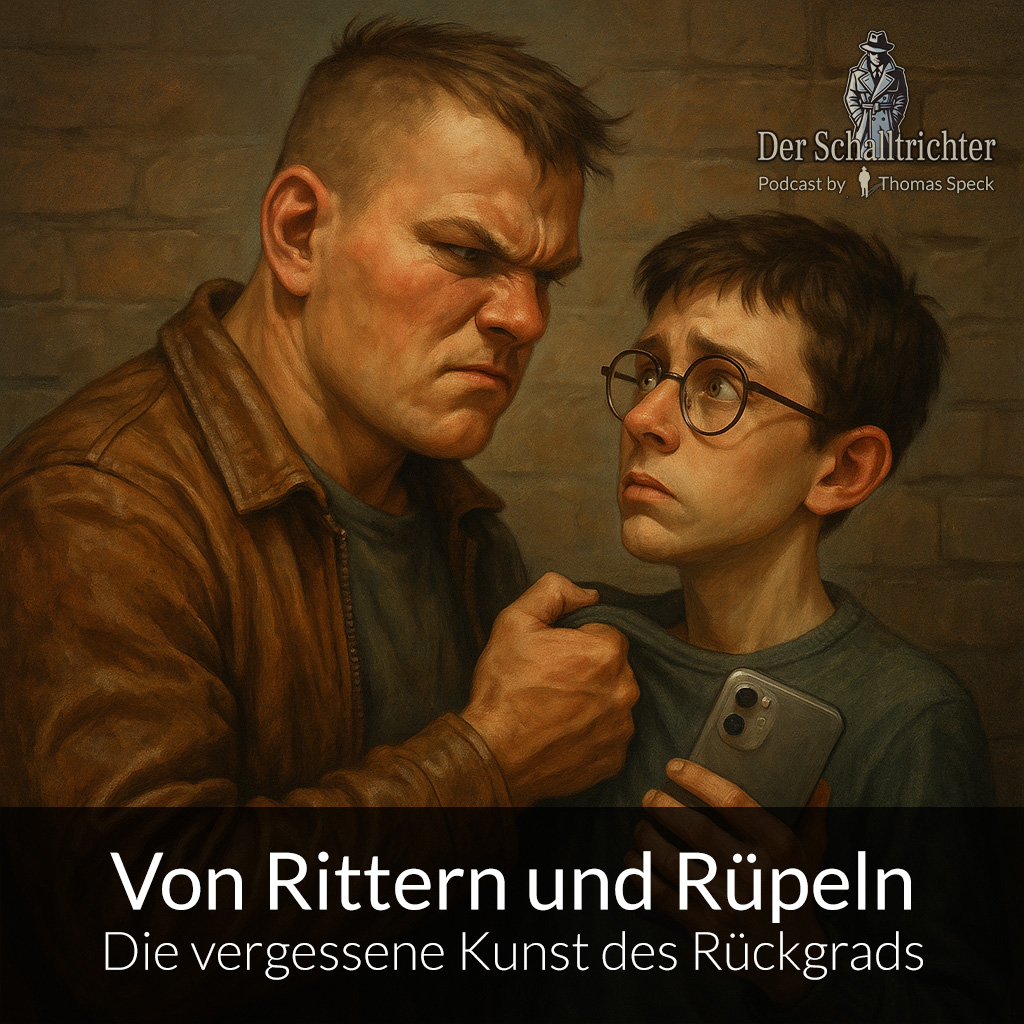
Was ist aus der guten alten Ritterlichkeit geworden?
Was ist mit dem Mut, nicht auf die Kleineren einzudreschen, sondern sich zwischen sie und den Schläger zu stellen?
Wer auf dem Schulhof noch auf jemanden eindrosch, der schon am Boden lag, galt nicht als stark – sondern als ehrlos.
Ein fairer Kampf hatte Regeln, oft unausgesprochen, aber allgemein anerkannt: Einer gegen Einen, keine Tritte gegen den Kopf, und wer „Aufgabe!“ rief, durfte mit ein bisschen Restwürde aus der Sache raus. Heute scheint genau das Gegenteil zu gelten: Wer nicht nachtritt, verschenkt angeblich Chancen.
Es geht nicht mehr darum, ob man gewinnt – sondern, wie viel maximalen Schaden man anrichten kann.
Damals hieß es: „Wehr dich, Junge!“
Heute heißt es: „Flood the zone with shit“
Das Ergebnis ist nicht dasselbe – denn wie oft bleibt heute im Vergleich zu früher jemand wahrlich zerstört am Boden liegen?
Ich erinnere mich noch gut an den Schulhof unserer kleinen, damals noch bäuerlichen Gemeinde – so etwas gibt es heute eigentlich gar nicht mehr. Schulhof, das war eher ein betonierter Flecken auf dem Dach der Turnhalle und den obligatorisch unterhalb mit Kaugummi verklebten Sitzbänken. Es roch nach Erde, kaltem Schweiß und meiner leisen Hoffnung, unauffällig zu bleiben.
Dummerweise war ich an diesem Tag alles andere als unauffällig.
Ich war der Typ, der mit Geschichten im Kopf und Angst im Brustkorb zwischen den Fußballspielern und Kartoffelsackträgern herumstolperte. Einer dieser „Denker“, wie es mein Lehrer halb bewundernd, halb ratlos nannte – heute würde man mich wohl „Nerd“ nennen. Was in der bäuerlichen Hierarchie von Hitzendorf ungefähr zwischen „Kaninchenzüchter“ und „Mathelehrer“ rangierte.
Er hingegen – nennen wir ihn Hansi – war der Anführer der hiesigen Mobbingbande. Ein halben Kopf größer, drei Jahre voraus in Muskelmasse, aber etwa fünf Jahre zurück in Sachen Empathie. Seine Oberarme wirkten wie aus geschnitztem Holz, vermutlich geformt durch das tägliche Schleppen von Mistgabeln, Milchkannen und kleineren Cousins.
Er hatte eine seltsame Methode der Kontaktaufnahme: Er boxte mir wiederholt gegen den Oberarm. Nicht bösartig – eher wie ein Schmied, der prüft, ob das Eisen schon heiß ist.
Ich ließ es geschehen. Nicht, weil ich feige war naja, vielleicht doch ein bisschen – sondern weil ich hoffte, dass er einfach aufhören würde, wenn ich es nur lang genug ignorierte.
Das war ein Irrtum.
Er packte mich plötzlich, schob mich grob gegen die Mauer neben den Stiegen und brüllte:
„Wehr di endlich!“
Ich schüttelte den Kopf. „Nein.“
Er war fassungslos. Nicht wegen meines Widerstands – sondern wegen meines Mangels daran.
„WEHR DI ENDLICH!“ rief er wieder – als würde er auf ein Losungswort warten, das ihm endlich erlaubte, mich mit gutem Gewissen zu verdreschen.
„NEIN.“
Doch dann… lachten sie.
Die anderen Buben natürlich – das gehörte zur Folklore.
Aber schlimmer war das leise Gekicher der Mädchen. Dieses zischelnde, abwertende Lachen einer Charlotte oder Jaqueline, das einem mehr Ehre abtragen konnte als zehn verlorene Kämpfe.
Ich spürte, ich konnte nicht länger „Nein“ sagen. Nicht, wenn ich in dieser rauen Dorfdiplomatie bestehen wollte.
Also schlug ich zurück – unkoordiniert, verzweifelt, vermutlich mit der Eleganz eines fallenden Mehlsacks.
Und sofort war Hansi auf mir. Wie ein ausgewachsener Rindviehbulle sprang er mich an, packte mich in den Schwitzkasten – und drückte zu.
Seine Stimme vibrierte neben meinem Ohr:
„Gibst du auf?“
Ich röchelte. Ich rang. Ich dachte an meine Ehre.
„Gibst du auf?“
Ich schwieg.
„GIBST DU AUF?“
Ich sagte lange nichts.
Bis ich endlich, röchelnd, doch sagte:
„Ja.“
Er ließ mich los, rempelte mich noch einmal in den Staub, lachte laut auf – ein Lachen wie aus einem Westernfilm, in dem der Bösewicht gerade seinen Triumph feiert – und ging.
Später, in den Diskotheken – oder den Spelunken, die man damals so nannte am Land – wurde es nicht unbedingt zivilisierter.
Nur eben lauter, schwitziger und deutlich alkoholgetränkter. Besonders in der Tanzbar Trost in Söding – einem Ort, dessen Name eine gewisse Ironie mit sich brachte: Trost spendete dort höchstens der DJ, wenn er versehentlich eine Ballade auflegte.
Ich ging gerne tanzen. Ich konnte es sogar gut. Und manchmal tanzte ich mich in die Herzen von Mädchen, auf die andere bereits still ihre Besitzansprüche angemeldet hatten – durch Blicke, Bier oder das seitliche Aufstellen der Schultern.
Damit war ich im Grunde ein Sozialverbrecher mit Taktgefühl.
Ich selbst geriet aber nur einmal in eine handfeste Schlägerei.
Ich verlor sie – sagen wir’s, wie’s ist – mit wehenden Fahnen.
Es war eine dieser Situationen, in denen man sich später gerne einredet, man habe „wenigstens die Haltung bewahrt“, obwohl man in Wahrheit bloß auf dem Linoleumboden zwischen Zigarettenstummeln und Kronkorken lag, während jemand rief:
„He, is a scho guat, jetzt!“
Aber was ich dort über die Jahre sah, war von ganz anderem Kaliber als die harmlose Schulhof-Rauferei.
Da wurde nicht geboxt – da wurde geprügelt.
Da knallten Biergläser, Ellbogen und manchmal Köpfe aufeinender.
Und doch: Es gab Regeln.
Wenn einer am Boden lag, war Schluss.
Wer weitermachte, verlor nicht nur Ansehen – er verlor den Schutz der eigenen Gruppe.
Wurde einer zu brutal, hielten ihn seine eigenen Kumpel zurück.
Wenn niemand da war, sprangen wildfremde Umstehende dazwischen – mit der Selbstverständlichkeit eines Bierdeckel-Ritters.
Es wurde laut. Es wurde hässlich.
Aber es hatte Struktur.
Kein Nachtreten. Kein „Teebagging“ – diese ekelhafte zur Schau gestellte „Lutsch meine Hoden“-Geste, bei der sich der Sieger auf das Gesicht des Besiegten hockt.
So etwas hätte selbst die härteste Clique mit einem „Geh, schleich di“ beendet.
Keine große Demütigung zur Unterhaltung der Menge.
Im schlimmsten Fall kam – hin und wieder – die Rettung.
Die Polizei? Kam erstaunlich selten.
Weil sie eben selten gebraucht wurde – man regelte das selbst.
Mit Handschlag, Faust – und der Floskel: „Passt schon wieder.“
Wie oft haben die Kontrahenten danach Handschlag getauscht und zusammen ein Bier getrunken.
Keine Entschuldigungsorgien. Keine Mediationsrunden. Keine Täter-Opfer-Dynamiken auf Instagram.
Einfach zwei geschwollene Augenbrauen, ein schiefer Grinser – und dann wurde die Runde fortgesetzt.
Damit war’s gut.
Heute wird immer noch gekämpft.
Aber nur noch selten auf Schulhöfen oder in Diskotheken und wenn, dann wirds meistens schlimm, denn Regeln gibt es nicht mehr. Das Recht des Stärkeren ist einer Lust an der Zerstörung gewichen.
Heute wird viel eher mit Worten geschlagen, Klicks und Screenshots. Der neue Pausenhof ist der digitale Raum.
Hier tritt keiner mehr offen gegen jemanden an.
Der klassische Schwitzkasten ist passé – ersetzt durch viel auch viel feigere Mittel: die Kommentarspalte.
Die Täter sind Gesichts und Namenslos.
Die Waffen sind Empörung, Screenshots, Hashtags.
Und der Kampfmodus ist kein „Einer gegen Einen“ mehr, sondern „Alle gegen Einen“.
Kollektive Entrüstung auf Knopfdruck – gerne ohne Zusammenhang, Kontext oder Nachdenken. Hauptsache, es wird laut.
Ein Shitstorm ist kein Kampf – es ist eine digitale Lynchversammlung, bei der niemand Verantwortung trägt, weil alle nur „mitgemacht“ haben.
Der, der lauter schreit, gewinnt – nicht der, der Recht hat. Und wenn jemand am Boden liegt, wird nicht verschont – sondern weiter gegoogelt, analysiert und öffentlich seziert.
Früher sah man seinem Gegner in die Augen.
Heute sieht man sein Profilbild – wenn überhaupt.
Die neue Form der Auseinandersetzung ist entkörpert, enthemmt und dabei erschreckend effizient.
Sie verletzt nicht nur, sie bleibt ewig abrufbar, jederzeit reproduzierbar und immer wieder teilbar.
Es wird nicht mehr geschlagen – es wird gespeichert und auf Lebenszeit gedemütigt.
Und der größte Unterschied ist: es gibt kein „Passt schon wieder“.
Kein Bier danach, keinen Handschlag.
Nur noch peinliche Stille – oder die Stille vor dem nächsten Sturm.
Diese Veränderung, dieses allmähliche Abgleiten von Regeln zu Reflexen, von Anstand zu Angriffsfläche – das beobachte ich schon lange.
Und je länger ich hinschaue, desto mehr fällt mir auf: Es bleibt nicht bei den Schulhöfen und Kommentarspalten.
Das öffentliche Leben selbst hat sich mitverändert.
Nehmen wir die Politik.
Ich weiß, das ist ein Reizwort.
Aber sehen wir’s nüchtern – oder sagen wir: so kühl wie der Händedruck nach einer verlorenen Disko-Schlägerei.
Früher mussten sich Politikerinnen und Politiker zumindest bemühen, den Eindruck zu erwecken, für „alle“ da zu sein.
Da war noch diese seltsame Vorstellung von Verantwortung – oder zumindest die Show davon: Ein Besuch in der Suppenküche, ein feuchter Händedruck mit einem Werktätigen, ein Satz wie „Wir hören zu“.
Heute reicht ein Slogan.
Ein schnittiges Video mit dramatischer Musik.
Eine Parole, möglichst simplifiziert und memefähig.
Ein Feindbild, das leicht zu retweeten ist.
Nicht das Beste setzt sich durch, sondern das Lauteste. Das Vereinfachte. Das Reißerische.
Die politische Klasse verwendet nur die Mittel, die heute salonfähig sind – nicht, weil sie dumm wäre, sondern weil sie gelernt hat, was wir sehen wollen.
Ein bisschen Drama. Ein bisschen Polarisierung.
Und wenn möglich: keinen Zweifel – der stört nur den Flow.
Meine These ist deshalb: Wir bekommen die Politik, die zu unserer Gegenwart passt.
Oder, noch unangenehmer formuliert:
Wir gestalten die politische Führung selbst, durch das, was wir zulassen, belohnen, durchwinken.
Das zeichnet natürlich ein etwas anderes Bild von unserer Gesellschaft, nicht wahr?
Vielleicht liegt das Problem weniger „bei denen da oben“, sondern bei unserem kollektiven Blick nach unten.
Denn wenn niemand mehr aufsteht, um dazwischenzugehen – wer will dann regieren, ohne zu treten?
Ja, früher gab’s auf die Fresse.
Und heute gibt’s einen Shitstorm.
Und zur Zeit endet beides selten mit einem Bier.
Vielleicht brauchen wir heute doch keine neuen Anführer, sondern einfach nur ein paar Leute, die wieder den Mut haben, dazwischenzugehen.
Nicht um zu glänzen – sondern um zu verhindern, dass der Nächste liegenbleibt.
Denn Ehre ist nicht das, was man gewinnt.
Sondern das, was bleibt, wenn keiner hinschaut.

