Früher war alles besser. Punkt.
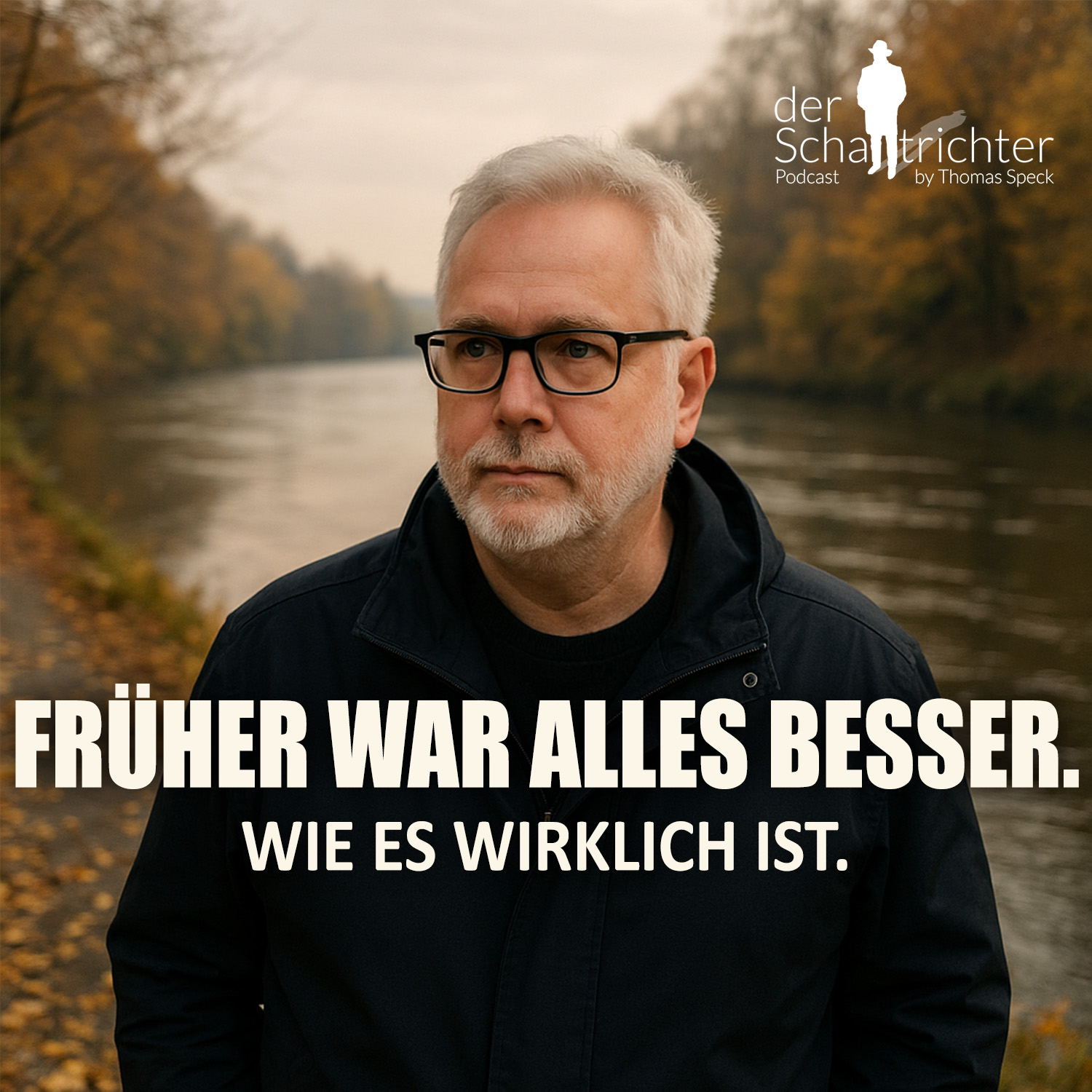
Ein leiser Monolog über das Früher, das Heute – und die Kunst, mit weniger Wissen mehr zu fühlen.
Neulich hab ich mir drei Paar Socken bestellt, und sie kamen am nächsten Tag.
Als Kind hab ich drei Monate auf ein Quartett gewartet – und es war das beste Spiel der Welt.
Was ist da eigentlich passiert?
Deshalb: Früher war es besser. Natürlich war es das.
Man musste sich ja nicht ständig von anderen anhören, dass es früher noch besser war.
Was hätten mir Oma oder Opa denn bitte vorschwärmen sollen von ihrem „früher war’s besser“?
Die Vertreibungen? Den Krieg? Die Nazis? Vielleicht die Weltwirtschaftskrise – oder den ersten Weltkrieg gleich mit?
Nein danke.
Mein Früher war besser als Euer heute. So einfach ist das.
Man lebte einfach – im Halbschatten des Mangels, mit einer gewissen Demut vor dem Unbekannten. Nicht aus Überzeugung, sondern weil es halt so war.
Wir hatten keine Überzeugungen nötig – rechts, links, vegan? Wir haben einfach mal gelebt. Wir haben getan was wir konnten.
Und das machte es erträglicher als dieses hyperinformierte Jetzt, in dem jedes Kind mit WLAN geboren wird und trotzdem nicht weiß, wie man eine Jacke richtig aufhängt.
Damals – also früher, bevor die Zukunft sich in peinlicher Selbsterkenntnis verhedderte – war das Leben irgendwie noch in Ordnung.
Man wusste, dass man nicht alles wusste – und das reichte völlig.
Und war zufrieden damit.
Und heute? Googelt man sich diese gnädige Unwissenheit kaputt.
Ich spaziere wieder einmal entlang der Mur. Mein Körper braucht etwas Ruhe, nach den letzten aufregenden Tagen.
Der Fluss fließt, wie immer – nicht schneller, nicht klüger, nicht besser vernetzt in irgendeinem Mobilfunknetz. Träge und gemächlich Richtung Kraftwerk.
Der Wind pustet mir feuchte Kälte unter die Jacke, als wolle er mir sagen: „Na, alter Freund – du bist ja immer noch am leben“ Gelbes Laub umspielt meine Beine und ich genieße das. Bei dem Wetter ist kaum jemand draußen und ich habe die ganze Ruhe für mich allein.
Ich denke nach. Über die „gnädige Unwissenheit“, die ich gerade so salopp hingeschrieben habe.
Sie war ja da, früher.
Weniger aus Faulheit oder weil wir dümmer waren.
Sondern, weil das Wissen nicht aufdringlich war.
Es hat nicht an jeder Ampel auf uns gewartet, nicht beim Einschlafen geplärrt, nicht beim Zähneputzen vibriert.
Es hat sich versteckt – in Bibliotheken, in Gesprächen, in der Stille.
Und man musste es sich holen. Nicht stumpf draufklicken – tatsächlich losziehen und holen.
Heute weiß man alles. Sofort.
Man erfährt, dass ein Vulkan ausbricht, während der Deckel der Kaffeekanne noch klappert.
Man kennt jedes Problem, jeden Skandal, jedes Meme – aber man kennt kein Maß mehr.
Und das macht mürbe. Mich, zumindest manchmal.
Ich vermisse die Zeit, in der man noch sagen konnte:
„Keine Ahnung. Hab ich nicht mitbekommen.“
Und niemand hat einen schief angeschaut.
Heute ist Unwissenheit irgendwie verdächtig – dabei war sie früher fast schon eine Tugend.
Ein stiller Raum im Kopf, in dem man denken konnte, statt zu vergleichen.
Vielleicht ist das mein größtes Problem mit dem Heute:
Es weiß zu viel – und fühlt zu wenig. Deswegen ist Unwissenheit manchmal wirklich etwas gnädiges. Heute ist man ja getrieben davon immer up to date zu sein.
Ich dagegen … ich spaziere lieber mit einer Lücke im Wissen durchs Leben – aber dafür mit Platz zum Denken. Während sich der Rest der Welt das Denken in 30 Sekunden Portionen vorformulieren lässt.
Was macht das mit mir?
Ich merke es, wenn ich hier so gehe.
Wenn die Welt um mich herum schneller wird, schärfer, lauter – und ich manchmal das Gefühl habe, leiser geworden zu sein.
Nein, nicht stumm. Nur… nicht mehr dauernd bereit, sofort alles mitzumachen.
Viele sagen ja immer: „Ach, damals war die Welt noch in Ordnung.“ Irgendwie ist das falsch.
Und doch … Tja. Es stimmt auch ein bisschen.
Weil man diese Welt noch nicht aus 37 Perspektiven in 4K und mit Untertiteln gesehen hatte. Die Katastrophen von damals waren wenigstens diskret – die brannten irgendwo weit weg, und das Fernsehen hatte zu dieser Zeit meist Sendepause.
Man redet heute so viel über Achtsamkeit – früher hieß das einfach „tritt nicht auf die Sense“. Und die Leute waren konzentriert! Denn Unkonzentriertheit tat meist weh.
Wenn man telefonierte, dann mit einer Person. Und wenn man auflegte, war die Verbindung wirklich beendet – nicht dieses psychologische Dauer-Onsein, das man heute „Erreichbarkeit“ nennt.
Früher war auch die Jugend besser.
Sie hatte wenigstens noch das Rückgrat, anders sein zu wollen, statt sich in einer App nach Individualität filtern zu lassen. Da schrieb man Protestlieder, keine Posts. Und man rebellierte mit Dosenbier, nicht mit Dinkelkeksen.
Wir waren vielleicht nicht klüger – aber schwerer zu täuschen.
Man konnte uns nicht einfach mit einem Rabattcode oder einem YouTube-Testimonial umstimmen.
Wir misstrauten allem, was zu glatt war. Und das war oft schon die Frisur vom Politiklehrer.
Aber, hm… war das tatsächlich besser?
Haben wir nicht genauso auf den Stolz und die Würde der Alten gepfiffen?
Vielleicht rebelliert jede Generation – und merkt erst später, wie still manche der Kämpfe waren,
die von den Alten geschlagen wurden.
Für die Kinder. Für ihr heutiges Leben.
So wie meine Großeltern durch zwei Kriege und furchtbare Zeiten gehen mussten, damit ich es einmal besser habe.
Ohne späteres Tamtam.
Ohne Story.
Ohne Dankbarkeit zu erwarten.
Und jetzt sind wir die, an denen gerüttelt wird.
Und das ist okay.
Ich habe damals auch nicht an meine Großeltern gedacht.
Oder an meine Eltern – und was sie alles aufgeben mussten für mich.
Ich wollte einfach nur so viel Leben wie möglich in mich aufsaugen.
Es ist das Vorrecht der Jugend, zu rebellieren – das Alte zu hinterfragen, es umzustoßen, zu erneuern.
Und das ist gut so.
Denn ohne diesen Aufbruch wären wir ja noch immer dort, wo wir nie mehr hinwollen.
Aber genauso ist es das Vorrecht der Alten, manchmal wie ein Anker zu sein.
An Dingen festzuhalten.
Nicht aus Trotz, sondern aus Zärtlichkeit gegenüber dem, was war – und was sich bewährt hat.
Ich verstehe das heute besser.
Früher – als junger Mensch – hätte ich mich über mich selbst lustig gemacht.
„Na schau, der Alte ist aber ein Spiesser.“
Aber heute weiß ich:
Manche Dinge sollen sich nicht verändern.
Nicht alles muss optimiert, digitalisiert, disruptiert oder neugestaltet werden.
Denn wenn sich alles bewegt – wo bleibt dann der Halt? Wo bleibt denn da meine Sicherheit, meine Ordnung?
Es ist kein schönes Gefühl, wenn man plötzlich in einer Welt steht, die man nicht mehr erkennt – in der man scheinbar keinen Platz mehr hat. Wenn alles schneller wechselt, als man lernen kann, wie das Neue überhaupt funktioniert.
Dann wünscht man sich manchmal einfach:
Dass wenigstens ein Stuhl noch dort steht, wo man ihn gestern abgestellt hat.
Aber gut. Vielleicht muss man einfach einsehen:
Die beste Zeit ist immer die, über die man nicht mehr sprechen muss.
Weil sie einfach war. Weil sie vergehen durfte, ohne zur Instagram-Retrospektive zu verkommen.
Und weil man noch nicht ständig erklären musste, warum früher alles besser war.
Ja – es war vieles besser, weil es eben einfach schlechter sein durfte. Wir waren arm, hatten wenig. Aber das wussten wir gar nicht.
Wir hatten nämlich alles, was man brauchte.
Wie soll man den Jungen erklären, was Vorfreude auf etwas ist, was Sparen bedeutet oder das lange Hinarbeiten auf ein Ziel?
Wenn alles immer sofort verfügbar ist – was bleibt dann noch, worauf man sich freuen kann?
Was soll man sich wünschen, wenn man schon alles hat, bevor man weiß, dass man es überhaupt braucht?
Wie soll man ihnen erklären, wie schön das Warten sein konnte – wenn sie nie lernen mussten, dass Geduld auch ein Geschenk sein kann? Wie soll man das erklären – in einer Welt, die sofort alles liefert, aber nie das, was wirklich fehlt?
Aber das Schönste an früher war:
Man wusste gar nicht, dass es früher war.
Man dachte, es sei einfach das jetzt.
Und so ist es auch heute wieder. Nur dass wir es diesmal wissen – und uns die Illusion damit gründlich ruinieren.
Also ja:
Früher war alles besser.
Nicht, weil es wirklich so war – sondern weil man es erst heute so sagen kann.

