Fortschritt? Nein danke, wir haben QWERTZ!
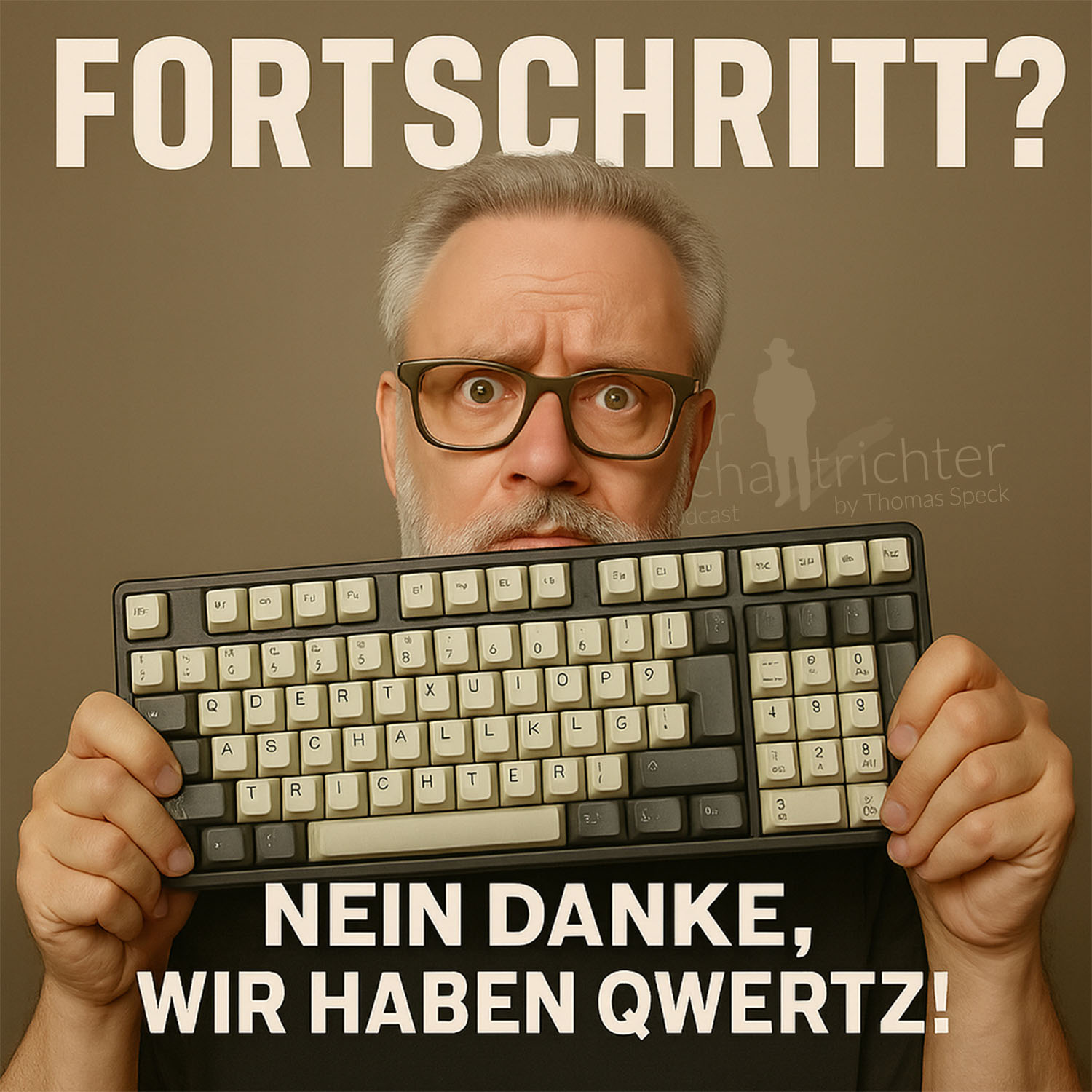
Willkommen in der herrlich absurden Welt der „digitalen Innovation“, wo PDF-Formulare die Zukunft versprechen – und dich dann doch zurück ins Jahr 1983 katapultieren. In dieser Episode sezieren wir mit scharfem Witz die kafkaesken Rituale deutscher Bürokratie, bei der digitale Anträge am Ende doch per Fax geschickt werden und Identifizierungs-Apps mehr Hürden bieten als ein olympisches Qualifikationsturnier.
Stellen wir uns vor, Du möchtest einen Antrag stellen.
Einen ganz normalen Antrag, digital zum downloaden – ob für den Steuerausgleich oder den Bau eines Gartenschuppens, völlig egal.
Die Behörden sind ja modern geworden, sie bieten uns das Formular jetzt online an: ein PDF zum download und ausfüllen – eigentlich eh schon wieder ein alter Hut.
Reizend ist auch, das man uns ermöglicht, das Ding gleich am Pc auszufüllen.
Das klingt nach Zukunft, nach digitalem Fortschritt, nach Silicon Valley im Amtszimmer.
Und dann kommt die Realität, und das sieht so aus:
Um ihren Antrag einzureichen, Drucken Sie das ausgefüllte Formular aus, unterschreiben Sie es und schicken es uns per Email oder Fax.
Ergo: Ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben, einscannen, hochladen, absenden.
Erleichterung als Kasperltheater in sechs Akten.
Digitalisierung heißt also: Papier per WLAN zu bewegen.
Das ist kein Fortschritt, das ist ein Hindernislauf im Bürokraten-Parcours. Und wir reden heute darüber, das wir viele dinge machen, weil sie immer schon so gemacht wurden – das nennt sich Path Dependence – Pfadabhängigkeit.
Das Antrags PDF ist der Inbegriff der digitalen Mogelpackung.
Es sieht modern aus – eine Datei, ein Formular, hübsch modern auf dem Bildschirm.
Man klickt brav die Felder an, tippt seine Daten ein, und denkt: Jetzt bin ich angekommen im 21. Jahrhundert.
Doch nein – das PDF ist der Trojaner der Bürokratie.
Es tut so, als wäre es Zukunft, dabei schleppt es nur die Mumie der Vergangenheit im Rucksack mit.
Denn am Ende landet man wieder beim Drucker, beim Scanner, beim Fluchen – Digitalisierung als Zeitreise ins Jahr 1983. Wer keinen Scanner hat, fotografiert sein Formular mit dem Handy und schickt ein krummes JPEG, auf dem der Kugelschreiber wie ein dünner Schatten aussieht. Das ist keine Digitalisierung, das ist Papier-Recycling mit Internetzugang.
Die Bürokratie hat es geschafft, das Schlechteste aus beiden Welten zu verbinden:
Die Umständlichkeit des Analogen und die Sterilität des Digitalen.
So entsteht ein seltsames Ritual:
Erst alles brav online eintippen, dann das Ganze wieder in Papier verwandeln, um es erneut digitalisieren zu dürfen – ein bürokratisches Perpetuum mobile.
Lustig ist, das es so gewollt ist. Ich meine, wer denkt sich sowas eigentlich aus?
Sitzt irgendwo in den Katakomben der Amtsstuben ein kleines Kontrollmonster, das nur dann zufrieden brummt, wenn es einen echten Kugelschreiberstrich sieht?
Digitalisierung, ja – aber bitte nur mit Tinte und Stempel.
Und als wäre dieses PDF-Ballett nicht schon absurd genug, hat man uns inzwischen sogar ein digitales Upgrade spendiert: die elektronische Identifizierung per App.
Klingt wieder fein nach Zukunft, klingt nach: „aber jetzt wirklich endlich ohne Papierkram“.
In Wahrheit ist es wie ein entzündeter Blinddarm: man könnte darauf verzichten, aber irgendjemand bestand darauf, ihn einzubauen – und jetzt tut’s weh.
Die Logik dahinter ist herrlich. Denn: das APP funktioniert auf Handys mancher Hersteller schlichtweg gar nicht – was die Anwendung an sich schon weit entfernt von nutzbar macht.
Klappt es doch, bekommt man zur Sicherheit erst einmal einen Code per Post zugeschickt – jawohl, per Brief, in echtem Papier, ausgedruckt auf einem Nadeldrucker, der wahrscheinlich noch im Keller des Innenministeriums surrt. Und im Kuvert ist dann noch so ein dunkles Muster aufgedruckt, damit man den Code gegen das Licht nicht erkennen kann. Gehts noch – für die Modernisierung greifen wir auf 100 Jahre alte Techniken zurück?
Und dann tippt man diesen Code in die App ein, die daraufhin weitere Codes anfordert, Passwörter verlangt und am liebsten noch ein Selfie mit Ausweis und neutralem Gesichtsausdruck.
Das Ganze wirkt nicht wie Benutzerfreundlichkeit, sondern wie eine digitale Mutprobe: Wer das Prozedere überlebt, ist offenbar würdig, seine eigene Identität bestätigt zu bekommen.
So entsteht Sicherheit nicht durch Klarheit, sondern durch digitale Erschöpfung.
Am Ende ist nur eines todsicher: Dass man nach zwei Stunden, wenn der Müll auf vielen Handys denn überhaupt funktionieren würde, doch lieber wieder zum Kugelschreiber greift.
Warum ist das so?
Weil Bürokratie nur auf eine einzige Weise gelöst werden kann:
Bürokratisch.
Das ist ihr Naturgesetz, so sicher wie die Schwerkraft.
Ein Antrag ohne Stempel ist in Amtsstuben ungefähr so wertvoll wie ein Geldschein ohne Wasserzeichen.
Denn was wäre ein Beamter ohne seinen Stempel?
Ein Priester ohne Weihwasser, ein Rockmusiker ohne Gitarre, ein Hund ohne Schwanz.
Der Stempel ist der Beweis einer Leistung – ihr wisst schon: abgestempelt bedeutet auch, der oder die Beamte hat seine Arbeit getan.
Unterschriften sind einfach Kringel auf Papier – aber sie werden zu heilige Glyphen durch die sakrale Handlung des „stempelns“. Wenn ein Stempel auf dem Papier ist, dann ist es sakrosankt und ein unumstößlicher Beweis.
Richtige Karteikastenfossilien, in denen sich der Bürokrat selbst verewigt:
„Seht her, hier war ich, ich habe geprüft, kontrolliert, gestempelt – ich existiere.“
So entsteht ein Universum, in dem nichts je wirklich einfacher werden darf.
Denn wenn etwas einfach würde, wozu bräuchte man dann noch den Herrn im Amt, der mit dem Stempel das letzte Wort spricht?
Oder die Frau im Sachgebiet, die genau weiß, dass Antrag B-17 nur mit Formular C-42 gültig ist, weil das so in Paragraph 13 Absatz 7 im LmaA Gesetzbuch festgelegt ist?
Die Bürokratie sichert ihr Überleben, indem sie sich ständig selbst reproduziert.
Ein neuer Antrag? Natürlich nur auf Basis des alten.
Eine neue Software? Selbstverständlich in der Logik der bisherigen Vorgehensweise.
Ein Identifizierungscode? Aber nur mit absolut sicherer Postzustellung.
Man könnte fast meinen, der Fortschritt selbst müsse in den Behörden erst einen Antrag stellen – in dreifacher Ausfertigung, bitte mit Stempel und Unterschrift.
Und so wie das Antrags-PDF uns im Kreis schickt, so fährt auch die Klimadebatte endlos im Kreisverkehr. Jaja – Alle wissen, wo die Ausfahrt ist – aber keiner biegt ab.
Da sind sich ja wirklich alle einig: Autos stoßen Abgase aus, Plastik vermüllt die Meere, Kohlekraftwerke sind so modern wie 56K Modems.
Wir wissen, was es verursacht, und wir wissen auch, wer es verursacht.
Und doch – was verändert sich? Richtig: nichts.
Der Verbrennungsmotor zum Beispiel.
Der trägt, nüchtern betrachtet, nur einen kleinen Bruchteil zu den globalen Emissionen bei.
Aber das Verbrenner-Auto ist das perfekte Symboltier.
Das Auto ist – wie das amtliche Antrags PDF – ein Pfad, den wir einmal eingeschlagen haben und aus dem wir heute nicht mehr herauskommen, weil wir längst ganze Zivilisationen drum herumgebaut haben.
Straßen, Parkplätze, Tankstellen, Autobahnen – alles fein säuberlich asphaltiert, ein einziger Teppich, der uns direkt in die Abhängigkeit führt.
Manchmal habe ich den Verdacht, die Städte wurden gar nicht für Menschen entworfen, sondern für Blechkisten mit vier Rädern, die nur zufällig auch einen Fahrer dabeihaben.
Und so haben wir Einkaufszentren auf der grünen Wiese – weit draußen, wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen. Dazwischen irgendwo Dörfer, in denen die letzte Milchkanne 1987 verkauft wurde.
Ohne Auto kommt man dort nicht mal mehr zum Bäcker, höchstens bis zur Bushaltestelle, wo der Busfahrer einem freundlich erklärt, dass er in drei Stunden wieder vorbeikommt.
Im Alltag ist das Auto längst viel mehr als Fortbewegung.
Es ist Statussymbol, Persönlichkeitsprothese, manchmal auch ein rollendes Wohnzimmer mit Sitzheizung und Navi – das einen zuverlässig in die Sackgasse der eigenen Abhängigkeit führt.
Wir haben das Auto zur Notwendigkeit erhoben.
Nicht, weil es das effizienteste oder ökologisch sinnvollste Verkehrsmittel wäre – sondern weil wir uns alles andere so lange abgewöhnt haben, bis nur noch das Auto übrig blieb.
Das ist der klassische Entwicklungs-Pfad in voller Schönheit: Die Wissenschaft nennt das Pfadabhängigkeit – ich nenne es das ewige Stolpern im immer selben Trampelpfad: Wir wissen, dass er im Sumpf endet, aber wir laufen trotzdem weiter, weil die Schuhe sich schon so schön eingelaufen haben.
Zuerst kommt die praktische Erfindung – Bewegung von A nach B.
Dann eine Infrastruktur, die Alternativen gnadenlos verdrängt – Straßen statt Schienen, Garagen statt Gärten.
Und schließlich ein System, das sich nur noch bestätigt: „Ohne Auto geht nichts mehr.“
Oder anders gesagt: Wir haben uns derart in den Wagen gesetzt, dass wir gar nicht mehr merken, wie tief wir schon im Stau stehen.
Auch für andere ist das Auto nicht nur ein Verkehrsmittel. Eher ein Symbol.
Es ist die Kuh, die so lange gemolken wird, bis sie umfällt – und dann wird ihr noch schnell ein Denkmal gebaut.
Die Großen, die davon profitieren, verhalten sich wie der alte Adel: nicht einen Schritt zurück, solange noch ein Tropfen Sahne in der Kanne ist.
Und wie sich das gehört, zeigt man mit dem Finger auf die kleinen Leute:
„Du sollst kürzer duschen, Bürger! Du sollst das Fahrrad nehmen, Bürger! Und wehe, du lässt den Motor laufen, während du beim Bäcker stehst!“
Währenddessen fährt die Konzernkarosse des Vorstandsvorsitzenden hinten am Bäcker vorbei – im Doppelpack, mit Chauffeur und Sicherheitswagen.
Man holt sich beim Kleinen, was die Großen nicht hergeben wollen. Weil die Kleinen davon abhängig sind und man sie deshalb auch leicht melken kann.
Das ist wie früher beim Fürsten: Der predigt Enthaltsamkeit und teilt Strafen fürs zu laute Magenknurren aus – während in seiner Küche der Braten für dreißig Personen schmort.
Nur heute heißt der Fürst nicht mehr Ludwig oder Karl, sondern Chief Executive Officer für ‚Sustainable Leadership Excellence in Green Future Synergies‘ – kurz: Herr Hofer.
Und das Menü besteht nicht aus Fasan und Reh, sondern aus Dividende und SUV.
Wir haben unsere Karren sparsamer zu fahren, um Co2 einzusparen – und die Fabriken die das Vehikel herstellen, pusten immer mehr davon in die Atmosphäre.
Die Großen erfinden die Regeln, die Kleinen sollen sie befolgen, und am Ende darf jeder Bürger stolz sein, wenn er die Plastiktüte zum zwölften Mal benutzt.
Das ist Klimaschutz als Puppentheater: oben ziehen die einen die Fäden, unten klatschen wir Holzköpfe Beifall, dass es nur so scheppert. Anstatt Alternativen zu erzwingen, müssen wir das Plastik entsorgen. Die innovation, die oben nicht gemacht wird, wird auf uns unten abgewälzt. Der Plastikflaschenpfand ist da ein gutes Beispiel.
Und so stolpern wir von einem Irrweg zum nächsten. Der eine auf Asphalt, der andere auf Papier der dritte auf dem Plastik und der nächste gleich hier, direkt unter unseren Fingern: das QWERTZ.
So und was ist das komische QWERTZ? Nunja, um den Titel dieser Folge zu erklären muss ich ja auch prominent drüber schreiben, nicht wahr?
Nun, das QWERTZ ist das Layout des Keyboards, auf der wir alle schon seit Jahrzehnten herumhacken.
Also nicht „Schlüsselbrett“ im metaphysischen Sinne, sondern ganz konkret: das Brett mit den Tasten, das in den 80ern unterm Commodore, den 90ern unterm Windows-Rechner und heute immer noch unter unseren Fingern liegt. Und diese Tasten mit ihren Buchstaben sind auf eine bestimmte Weise angeordnet.
Q-W-E-R-T-Z – das sind einfach die ersten sechs Buchstaben links oben.
Und deshalb nennt man das bei uns QWERTZ Layout.
Damals, als Männer noch Hüte trugen und Frauen sonntags im besten Kleid zum Kirchgang stolzierten, erfand jemand die Schreibmaschine.
Ein Wunderwerk! Metallhämmerchen, die mit elegantem Schwung gegen das Papier klatschten, während das Farbband dazwischen als stiller Schiedsrichter fungierte.
Endlich konnte der Mensch Gedanken maschinell vervielfältigen, statt sie mit Gänsekiel und Tintenfass in die Ewigkeit zu klecksen.
Doch wie es so ist mit dem Fortschritt: Er läuft selten auf Anhieb rund.
Die Hämmerchen der Schreibmaschine waren schneller beleidigt als zwei Trompeten im Duett – eine Note zu schnell und schon gab’s eine Arie aus Blech.
Drückte man nämlich zwei benachbarte Buchstaben zu fix hintereinander, verkeilten sie sich in zärtlicher Umarmung direkt vor dem Papier. Ein mechanisches Knäuel, das man nur durch energisches Rütteln, Schütteln und Fluchen wieder lösen konnte.
Die Lösung? Ganz einfach, indem man die Buchstaben so anordnete, dass jene die man oft hintereinander brauchte, möglichst nicht nebeneinander liegen.
Mit anderen Worten: Unsere Vorfahren erfanden ein System, das unseren Fingern beim Tippen doppelt so weit greifen lässt, als wirklich nötig – und wir nutzen das bis heute völlig gedankenlos.
Denn nichts beweist menschliche Genialität besser als die Fähigkeit, ein Hindernis nicht zu beseitigen, sondern es zur Norm zu erheben.
Ironisch betrachtet ist das QWERTZ Layout das Alphabet in Tastaturischer Zwangsjacke:
Die Buchstaben sind nicht da, wo sie sein sollten, sondern da, wo sie am wenigsten stören – für eine Technologie, die längst im Museum steht.
Warum also quälen wir weiter unsere Finger, statt das leichtere Dvorak Layout zu wählen, das es schon lange gibt?
Wir haben doch auch schon ebenso lange keine mechanischen Tastaturen mehr?
Weil wir uns daran gewöhnt haben – und weil alles drum herum sich darauf eingerichtet hat, wie beim Auto oder den Stempeln.
Wir haben Millionen Menschen auf diesem Layout ausgebildet, ganze Generationen tippen blind ihre Briefe, Bewerbungen und Liebeserklärungen.
Die Läden sind voll mit Tastaturen, Ersatzteile, Klebefolien, sogar ergonomische Spezialmodelle – alle im guten alten QWERTZ.
Ein Wechsel wäre unbequem: neue Bücher, neue Computer, neue Fingergewohnheiten – ein kleiner Weltuntergang.
Kurz: QWERTZ ist nicht die beste Lösung – es ist nur die billigste, bequemste und am tiefsten eingefahrene.
Es ist wie eine schlecht gelegene Bushaltestelle: keiner will dort stehen, aber keiner wagt, sie zu versetzen, weil man sonst den ganzen Fahrplan neu schreiben müsste.
Tja – und jetzt Hand aufs Herz:
Wir tun doch alle so, als sei das pdf, das mit dem Auto oder eben die Tastatur ein Systemproblem.
Dabei liegt die Wahrheit direkt unter deinen Fingern.
Weil DU dich nicht umgewöhnen willst. Weil es DIR zu unbequem wäre, noch einmal neu zu lernen, wohin deine Finger laufen sollen.
Darum stolperst du lieber weiter über dieselben Tasten, Jahr für Jahr, und klatschst Beifall dazu – wie ein dressiertes Huhn, das im Zickzack pickt und es „Tradition“ nennt.
Ja, ich weiß wie schwierig es psychologisch sein kann, ausgetretene Pfade zu verlassen – aus eigener Erfahrung weiß ich das. Man tuts eigentlich nur, wenn der eigene Seelenfrieden, die Gesundheit oder das Gesetz es von uns verlangt. Das hier soll nur dazu führen, das wir nicht immer nur die Augen davor verschliessen.
Und so sitzen wir da, zwischen PDFs und Plastiktüten, zwischen Autos und Tastaturen, und nennen es Gesellschaft.
Wir drucken Papier, damit es digital wird. Wir fahren Autos, weil wir zu wenig zeit haben, um mal zum Bäcker zu Fuß zu gehen. Wir retten das Klima, indem wir Plastiktüten falten, während irgendwo ein Containerschiff mehr Abgase ausstößt, als Du jemals in deinem Leben einsparen könntest.
Und wir hacken weiter auf QWERTZ, diesem steinzeitlichen Tastenfriedhof, weil uns das Umgewöhnen zu mühsam wäre.
Wir lieben das Vertraute.
Und wir fürchten das Neue.
Wenn wir dann mit unserer Karre im Stau stehen, auf dem Weg zum Amt mit unserem ausgedruckten PDF im Handschuhfach, schön eingepackt in einer Aktenhülle aus Plastik und auf QWERTZ getippt, dann murmeln wir im Chor: „Das war ja schon immer so.“
Ein Ausreden-Konzert in Dmoll, dirigiert vom Fortschritt, der wieder nicht gekommen ist.
Was wir tun, ist das, was wir schon immer taten, weil es immer schon so getan wurde.
Und wenn wir jammern, dass sich nichts ändert, dann jammern wir in Wahrheit über uns selbst. Denn wir sind es, die das Alte verteidigen wie eine Kuscheldecke – auch wenn sie schon längst verschimmelt ist.
Wir fordern Wandel, aber wandeln uns selber nicht.
Wir verlangen Zukunft, aber bitte in der Verpackung von gestern.
Wir selbst sind es, die mit beiden Händen am Gitter der Abhängigkeiten rütteln, während wir den Schlüssel in der Hosentasche tragen.
Und dann fragen wir allen Ernstes: „Warum macht denn niemand die Tür auf?“
Ja, mein Freund, weil es ja immer schon so gemacht wurde.

