Die große Freiheit? – Die verträgst du gar nicht!
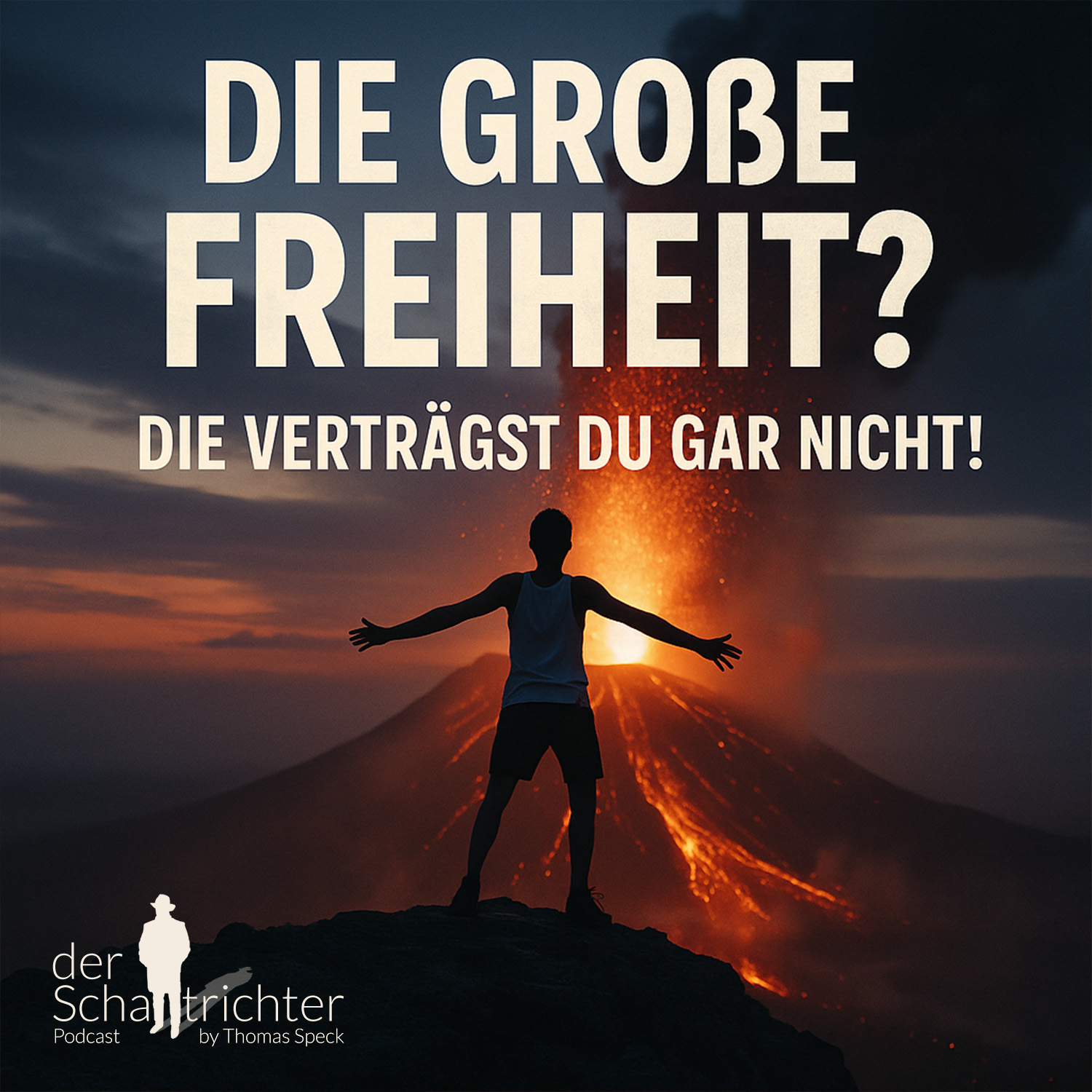
In dieser Folge des Schalltrichters dreht sich alles um ein Wort, das süß klingt und bitter schmeckt: Freiheit. Wir laufen ihr hinterher wie störrische Esel der Karotte – mal im Hamsterrad, mal auf der Bühne, mal brav am Buffet der Möglichkeiten.
Aber sind wir wirklich frei? Oder nur gut dressierte Käfigvögel mit WLAN?
Freiheit.
So ein schönes Wort, nicht? Zwei Silben, weich am Anfang, scharf am Ende. Freiheit. Das klingt nach wehendem Haar im Cabrio, nach sommerlichem Barfußlaufen durchs hohe Gras, nach… ja, nach allem, was wir selbst so hineindeuten, wenn wir es nur oft genug wiederholen.
Jeder weiß, was Freiheit ist — bis man ihn fragt. Dann wird es schnell ein wenig peinlich, wie beim Vorstellen neuer Kollegen auf einer Weihnachtsfeier: man nickt und lächelt, aber so richtig den Namen hat man nicht parat. „Freiheit? Na… das… also… das ist halt wichtig!“ ruft einer. „Für jeden was anderes“, ruft ein anderer. Und wieder einer brummt aus der letzten Reihe: „Hauptsache ich darf endlich wieder grillen!“
Man könnte also sagen: Freiheit ist ein Begriff, der uns ständig im Mund liegt, wie ein Bonbon, das nie kleiner wird. Man kann darauf herumkauen, es immer wieder drehen, lutschen, beschreiben — doch was wirklich drinsteckt, ist unklar. Zuckersüß? Bitter? Oder vielleicht nur Luft, hübsch in Folie gewickelt?
Die Politik ruft uns regelmäßig zu, wie wichtig sie sei — unsere Freiheit. Und wir klatschen brav, als hätten wir verstanden, wovon die Rede ist. „Freiheit!“, rufen die einen, „aber bitte nicht so laut, ich gucke gerade meine Serie.“ „Freiheit!“, rufen die anderen, „aber nur für die, die sich benehmen können.“ Und irgendwo sitzt ein Philosoph in seiner Bibliothek und murmelt leise: „Oh je. Schon wieder haben sie’s nicht begriffen.“
Wir tragen sie stolz wie einen Orden, diese Freiheit, und merken gar nicht, dass uns niemand je erklärt hat, wofür wir eigentlich ausgezeichnet wurden. Für unseren Mut? Für unsere Selbstbestimmung? Oder doch nur dafür, dass wir im Hamsterrad besonders schön laufen?
Ja, wir sind frei. Sagen wir. Fühlen wir. Glauben wir.
Aber… sind wir das? Ganz sicher?
Oder ist Freiheit vielleicht nur ein besonders hübsches Wort für die Karotte, die man uns vor die Nase hängt — so wie man einem störrischen Esel die Karotte an einer Angel vorhält, damit er brav weiterläuft?
Nun, sehen wir einmal genauer hin. Denn wer glaubt, frei zu sein, sollte sich zumindest die Frage stellen:
Wer hält eigentlich die Angel?
Wer die Angel hält, das bleibt natürlich ein gut gehütetes Geheimnis. Jedenfalls so lange, bis man anfängt, danach zu fragen. Die meisten tun das nicht. Wozu auch? Die Karotte schaukelt hübsch hin und her, es riecht verheißungsvoll, und solange man läuft, bleibt sie ja in Reichweite. Also laufen wir. Immer weiter.
Das Praktische an der Karotte ist: Sie muss nie tatsächlich gegessen werden. Es reicht vollkommen, dass wir glauben, sie bald zu erwischen. „Nur noch eine Beförderung“, sagen wir. „Nur noch dieses Haus abbezahlen. Nur noch eine Diät, ein Sabbatical, ein Selfcare-Retreat – dann bin ich frei.“ Und während wir uns schon auf den Geschmack freuen, zieht die Angel ein Stück weiter nach vorn.
Freiheit, das lernen wir früh, ist immer einen Schritt entfernt. So bleibt sie frisch. So bleibt sie begehrt. So bleibt sie ungefährlich.
Und während wir also dem Duft der Karotte folgen, merken wir nicht, dass wir längst nicht mehr auf einer grünen Wiese laufen. Wir laufen im Kreis. Immer im Kreis, auf blank poliertem Parkett, von golden glänzenden Gittern umstellt.
„Käfig?“ werden Sie jetzt vielleicht sagen. „Ich sehe keinen Käfig.“
Nein, den sieht man nicht sofort. Die Stäbe sind so elegant gebaut, dass sie in den Hintergrund verschwimmen wie schlecht abgetönte Wandfarbe. Vielleicht sind es die Schulden, die Erwartungen der anderen, der Status, den man sich nicht mehr abstreifen kann – jeder hat seine eigenen Stäbe, aber eines haben sie alle gemeinsam: Sie klirren leise, wenn man dagegenstößt.
Und doch: wir sind stolz auf diesen Käfig. Schließlich ist er bequem eingerichtet. Es gibt WLAN, Kaffeevollautomaten und Zimmerpflanzen in Terrakottatöpfen. „Schau nur“, sagen wir zu uns selbst, „wie frei ich bin! Ich darf auf dieser Stange sitzen oder auf jener. Ich darf von links nach rechts flattern, wann immer ich will.“
Nur rausfliegen, das geht irgendwie nicht.
„Wozu auch?“, denkt man sich dann. „Draußen ist es sicher furchtbar kalt. Und wer weiß, ob es dort überhaupt Karotten gibt?“
So hocken wir also im Käfig. In unseren schönsten bunten Federn. Wir flattern, wir schaukeln, wir sagen „Ich könnte jederzeit, wenn ich wollte.“ Und dann setzen wir uns wieder still auf unsere Stange und schauen der Karotte hinterher, die so verführerisch hin und her pendelt.
Vielleicht, so denke ich manchmal, besteht Freiheit nicht darin, die Stäbe wegzusägen.
Sondern darin, endlich zu merken, dass sie da sind.
Manche behaupten ja, sie hätten die Stäbe längst hinter sich gelassen. Sie seien völlig frei, selbstbestimmt, ungebunden. „Ich tanze nicht nach der Pfeife von irgendwem!“ rufen sie und schwingen dabei die Arme, dass die Fäden an ihren Handgelenken klimpern.
Und es ist tatsächlich ein hübscher Anblick, diese Bühne, auf der wir alle auftreten: links die stolzen Manager, rechts die selbsternannten Rebellen, in der Mitte die Influencer, die sich selbst filmen, wie sie angeblich völlig frei tanzen. Ein kunterbuntes Spektakel.
Nur dass über uns ein ganzes Netz aus Fäden hängt, das jemand anderes zieht. Mal sind es die gesellschaftlichen Erwartungen, mal die Notwendigkeiten des Marktes, mal einfach nur die kleinen stillen Urteile der Nachbarn, die einem von den Rängen zugerufen werden.
Wir bewegen uns auf der Bühne, bücken uns, springen, drehen Pirouetten — und merken gar nicht, dass jede unserer Gesten schon vorgegeben ist. Der Applaus gilt immer dem, der die Rolle besonders überzeugend spielt. Und wehe einer stolpert aus der Choreografie: dann sinkt der Vorhang schneller, als man „Autonomie“ buchstabieren kann.
Das Tragikomische ist: Wir halten uns dabei für unsere eigenen Puppenspieler. „Ich hab mich bewusst für diesen Job entschieden“, sagt der eine. „Ich habe aus freien Stücken geheiratet“, die andere. „Ich habe meine Meinung selbst gebildet“, ruft ein Dritter — während der Puppenmeister im Hintergrund schon die nächsten Fäden vorbereitet.
Manchmal, wenn die Scheinwerfer kurz aus sind, spüren wir es. Einen leisen Zug am Handgelenk. Ein Rucken im Rücken. Einen unsichtbaren Druck, der uns in Position schiebt. Und dann schauen wir kurz auf. Über uns: das Spinnennetz der Fäden, das über der ganzen Bühne hängt, mit Knoten und Schlingen und einem ganz dicken, schwarzen Faden, der seltsam leise summt.
Natürlich schauen wir schnell wieder weg.
Wer will schon sehen, dass er bloß Teil eines Marionettenspiels ist? Lieber blicken wir in den Spiegel an der Bühnenwand. Der zeigt uns, wie frei wir wirken. Wie elegant wir tanzen. Wie sehr wir die Zügel selbst in der Hand halten.
Der Spiegel lügt uns freundlich an. Und wir lügen freundlich zurück.
„Sieh nur“, sagen wir und ziehen die Fäden selbst ein bisschen straffer, „wie schön ich tanze.“
Ich vergleiche die Freiheit auch gerne mit einem Buffet. An diesem Buffet nämlich, so glauben wir, offenbart sich unsere Freiheit in ihrer ganzen Pracht: hier dürfen wir wählen. Soviel wir wollen. Was wir wollen. Wann wir wollen.
Vor uns glänzt die Fülle der Möglichkeiten, meterlang, mit kalten Platten und warmen Träumen: Berufe, Partner, Weltanschauungen, politische Positionen, Diäten.
„Alles, was Sie begehren!“, ruft der Oberkellner mit gezwirbeltem Schnurrbart, „Sie sind völlig frei in ihrer Wahl!“
Und tatsächlich: Wir schreiten auf und ab, die Augen groß, die Hände bereit, die Zange am Bratenstück. „Nehme ich das Selbstverwirklichungs-Schnitzel oder doch lieber das Karrierefilet?“ „Wähle ich den Fitness-Quinoa oder den Genuss-Cheesecake?“ Wir sind berauscht von den Möglichkeiten.
Nur… irgendwann, mitten im Trubel, merkt man: die besten Stücke sind längst vergriffen. Die, die satt und zufrieden am Fenster sitzen, haben sich längst bedient, noch bevor wir überhaupt die Zange in die Hand nahmen.
Die Schilder auf den Tabletts klingen vielversprechend, aber das, was man bekommt, schmeckt immer ein bisschen nach dem gleichen Industriegewürz.
„Wähle deinen Beruf, such dir dein Leben, finde dein Glück!“ — als wäre es ein Drei-Gänge-Menü. Aber wehe, jemand fragt: „Wo gibt’s eigentlich das, was die am Fenster haben?“
Der Oberkellner lächelt dann nur mild und schiebt das nächste Blech mit exakt denselben Häppchen nach.
Trotzdem … wir tun so, als wären wir frei. Wir lassen uns die Zange aus der Hand reißen, falls jemand anderes schneller greift. Wir reden uns ein: „Ich könnte alles haben, ich habe mich nur bewusst für dieses entschieden.“ Aber das Schöne am Buffet ist ja: Es gibt immer genug Servietten, um sich die Krümel der Enttäuschung diskret vom Kinn zu wischen.
Abseits der Tische, in einer dunklen Ecke, steht übrigens ein kleiner unscheinbarer Kellner mit verschränkten Armen. Der, so munkelt man, kennt die wahre Speisekarte. „Aber“, flüstert er einem ins Ohr, „die gibt’s nicht für alle.“
Dann dreht er sich um und verschwindet wieder in die Küche.
Und wir? Wir bleiben zurück. Mit unseren Tabletts, unseren halb kalten Tellern. Und murmeln, während wir kauen: „Hauptsache, ich durfte wählen.“
Hinterher beschweren wir uns über die mangelnde Auswahl — aber Verantwortlich sind natürlich die Köche. Nicht wir, die sich freiwillig entscheiden haben.
„Freiheit ohne Verantwortung?“ ruft einer entrüstet aus der Fensterreihe. „Das geht doch nicht!“
„Richtig!“ ruft jemand von hinten. „Verantwortung ist der Preis der Freiheit!“
Und alle nicken pflichtbewusst, wie in einem schlecht klimatisierten Abendkurs für Philosophie für Anfänger.
Ja, ja, die Verantwortung. Sie wird uns überreicht, sobald wir unsere ersten Schritte ins Buffetzimmer machen. „Hier bitte“, sagt man uns, „Ihre Portion Verantwortung. Nicht verlieren!“
Und wir nehmen sie entgegen, artig wie wir sind.
Man stellt sich das ja gern vor wie einen maßgeschneiderten Smoking: elegant, würdevoll, passt wie angegossen.
Aber was wir stattdessen bekommen, ist eher wie ein billiger Einheitsanzug: die Ärmel zu kurz, die Hosenbeine zu lang, der Stoff kratzt. „Bitte ziehen Sie ihn an“, sagt der Kellner streng, „so tragen ihn hier alle.“
Und also ziehen wir ihn an. Und grinsen tapfer.
„Sei solidarisch“, murmelt man uns zu, „verhalte dich normal, halte dich an die Regeln.“
„Hör auf dein Gewissen, aber bitte nicht zu laut.“ „Sei frei – aber verantwortungsvoll!“
Und weil das Wort Verantwortung so schön klingt, tun wir’s auch.
Wir nehmen Rücksicht. Wir halten uns zurück. Wir ordnen uns ein. Nicht zu viel, nicht zu wenig, genau so, wie man es von uns erwartet.
Denn das ist der Trick mit der Verantwortung: sie kommt immer hübsch verpackt daher, wie eine Einladung zum Ball. Erst später merkt man, dass man gar nicht tanzen darf.
Manche tragen ihren Verantwortungs-Anzug so stolz, dass man fast neidisch wird. „Schau mal“, rufen sie, „wie erwachsen ich bin! Ich trage Verantwortung für mich, für meine Familie, für die ganze Gesellschaft!“
Und dann hocken sie doch nur auf ihrer kleinen Stange im Käfig und winken den anderen zu.
Vielleicht, denke ich manchmal, ist diese Verantwortung ja gar nicht wirklich Verantwortung?
Wenn man uns selbst aussuchen ließe, welchen Anzug wir tragen wollen – wäre das nicht viel eher Verantwortung?
Vielleicht, denke ich weiter, sind wir ja einfach zu bequem für wahre Freiheit.
Denn wer sie wirklich will — nicht die dekorative Freiheit mit Karotte und WLAN, sondern die nackte, kompromisslose, gnadenlose Freiheit — der muss auch eines wollen:
die Verantwortung.
Und zwar die volle.
Ganz allein.
Für sich selbst.
Für jede Entscheidung.
Für jede Konsequenz.
Für jede verpasste Chance, jede falsche Abzweigung, jede Enttäuschung, die daraus folgt.
Wahre Freiheit heißt: du entscheidest. Und wenn’s schiefgeht, dann nur, weil du’s selbst so wolltest. Kein Kellner, kein Puppenspieler, kein Oberkellner im Buffetsaal, der die Schuld an deinen Entscheidungen tragen kann. Nur du.
Georg Danzer hat das einmal auf den Punkt gebracht, in seinem Lied „Die Freiheit“:
„Denn nur in Freiheit kann die Freiheit Freiheit sein.“
So schön, so schmerzhaft.
Denn das heißt ja auch: nur dann, wenn man bereit ist, sich selbst zu tragen — ohne Netz, ohne Ausreden, ohne Applaus — kann man von Freiheit sprechen.
Und hier liegt das Paradoxon, das wie eine unausgesprochene Pointe im Raum hängt:
Wenn wahre Freiheit so viel Verantwortung verlangt — und kaum jemand bereit ist, sie tatsächlich zu tragen – kann es dann wahre Freiheit überhaupt geben?
Oder ist sie am Ende nur eine Utopie, ein schöner Gedanke, mit dem wir uns trösten, während wir weiter brav die Karotte jagen?
Wahre Freiheit, so sagen sie, beginnt dort, wo du allein bist. Mit dir, deinen Entscheidungen, deiner Verantwortung – und ohne Ausflüchte.
Das klingt nur so lange romantisch, wie man noch auf sicherem Boden steht.
Denn in dem Moment, in dem du dich tatsächlich befreist von den Netzen, die dich halten – Familie, Nachbarn, Gesetze, Erwartungen – merkst du, dass unter dir kein Teppich liegt, sondern etwas anderes: ein Vulkan.
Glühend. Brodelnd. Und ständig kurz davor, auszubrechen.
Freiheit ist kein sicherer Ort. Freiheit ist ein Tanz auf glühendem Gestein, immer am Rand des Absturzes.
Zu viel davon, und du verbrennst dir die Füße. Zu wenig, und du sitzt wieder im Käfig.
Das Publikum ringsum schaut dir mit verschränkten Armen und klugen Sprüchen zu, wie du da deine eigenen Entscheidungen balancierst.
Doch du musst allein entscheiden, wohin du tanzt.
Es ist ein Tanz, der Demut verlangt. Und Schwindelfreiheit.
Denn jede falsche Bewegung kann nicht nur dich, sondern auch die um dich herum mit in den Abgrund reißen.
Deine Freiheit endet dort, wo die der anderen beginnt — und ihre beginnt dort, wo deine aufhört.
Ein ewiges Gezerre um Millimeter.
Das Fatale: Der Vulkan unter dir hört nie auf zu brodeln.
Die Gesellschaft, die du nicht stören sollst, die anderen, die du nicht gefährden darfst, die Ordnung, die du nicht ins Wanken bringen darfst — all das ist nur eine dünne, fragile Kruste über einem Lavastrom aus Egoismen und Ängsten, den keiner so genau sehen will.
Auf diesem Vulkan gelten keine Ausreden.
Niemand kann dir vorschreiben, in welche Richtung du dich drehen sollst.
Niemand trägt die Schuld, wenn du stolperst.
Niemand springt für dich, wenn du fällst.
„Und wem gehört der Vulkan?“ wirst du jetzt vielleicht fragen.
Ganz einfach:
Dir.
Niemandem sonst.
Denn Freiheit ist genau das:
dein Tanz, dein Risiko, dein Feuer.
Und nur wer den Mut hat, diesen Boden zu betreten, kann überhaupt von Freiheit sprechen.
Am Ende bleibt festzuhalten: Wir lieben die Freiheit.
Zumindest in homöopathischen Dosen.
Ein Häppchen hier, ein Fingerhut da – gerade so viel, dass es den Appetit stillt, aber bitte nicht so viel, dass uns schlecht wird.
Denn wir wissen doch gar nicht, was wir mit der ganzen Portion anfangen sollten.
Was würden wir denn tun, wenn wir plötzlich wirklich alles dürften? Wohin würden wir laufen? Wer wären wir ohne die Regeln, an denen wir uns so schön abarbeiten können?
Wir sind eben Herdentiere.
Und wo eine Herde ist, sind Regeln.
Und wo Regeln sind, ist die Freiheit immer schon ein bisschen kleiner, als wir es gerne hätten.
Manchmal gleicht das Leben einer Straße: links ein Graben, rechts ein Graben, und dazwischen darfst du dich so frei fühlen, wie du möchtest.
Du kannst kreuz und quer laufen, dich drehen, sogar umkehren.
Nur: die Straße führt trotzdem immer in eine Richtung.
Und während wir uns gegenseitig bewundern, wie individuell wir im Zickzack rennen, bemerken wir gar nicht, dass der Asphalt der Möglichkeiten vorgezeichnet ist.
Vielleicht ist das auch besser so.
Denn echte Freiheit – also ganz ohne Leitplanke, ohne Richtung, ohne Herde – würden wir gar nicht ertragen.
Wir würden uns verlaufen, uns fürchten, und uns sehr schnell eine neue Herde suchen, die uns sagt, wo es langgeht.
Und so nehmen wir eben weiterhin nur ein Häppchen von der Freiheit.
Mit reichlich Beilagen an Gewohnheit, Konvention und Sicherheit.
Und das Dessert heben wir uns für irgendwann auf.

